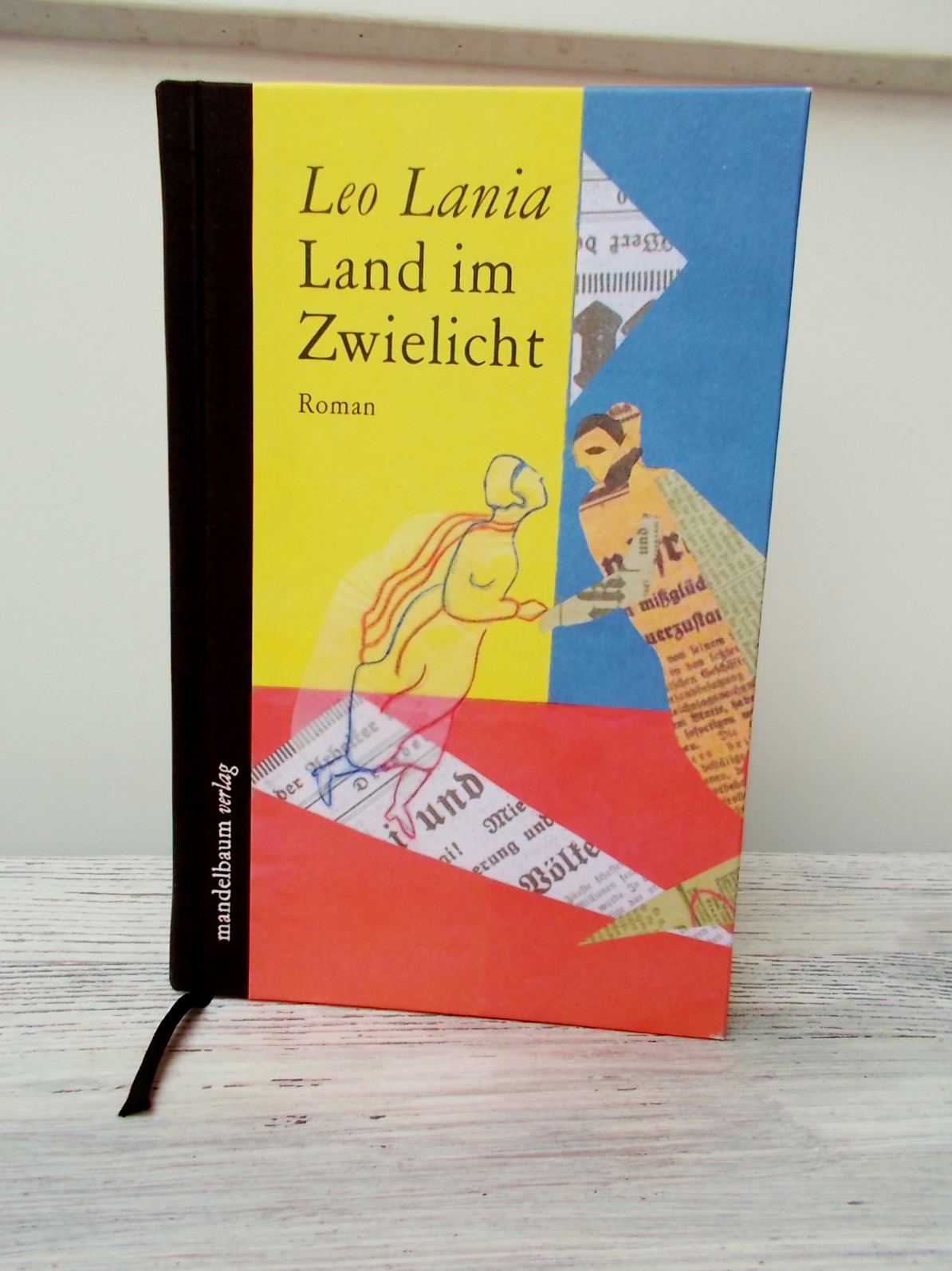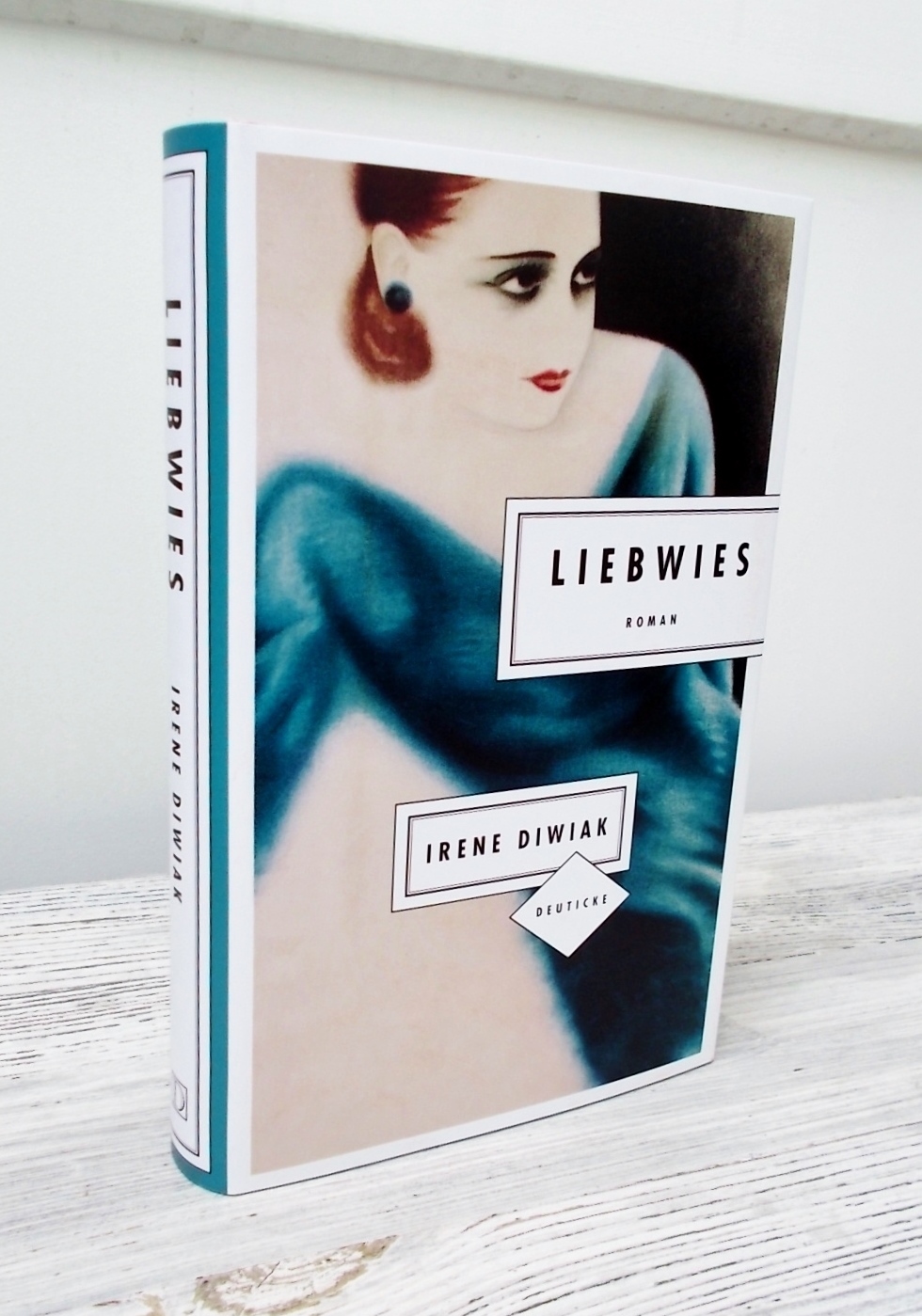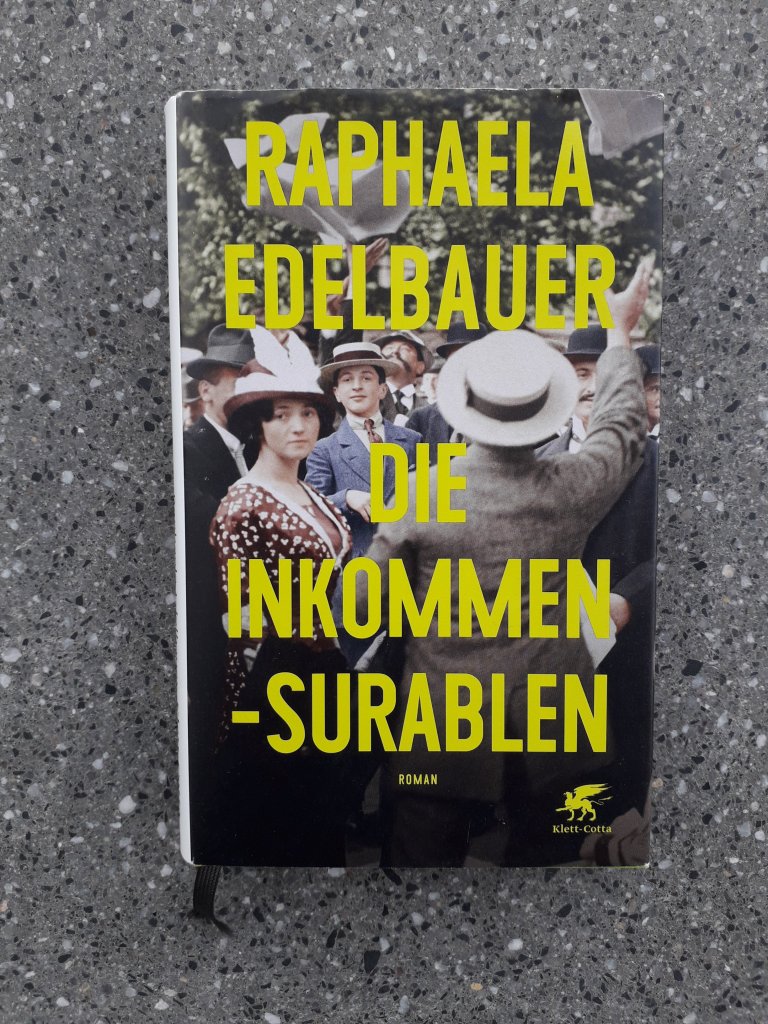
Es ist mein erster Roman von Raphaela Edelbauer. Beim Bachmann-Preislesen 2018 gefiel mir ihr Text bereits sehr. Und der neue Roman wurde als „Wien-Roman“ angekündigt; das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Lange schon habe ich den Roman beendet und es doch nie geschafft darüber zu schreiben. Ich frage mich, wie es kommt, dass sich manche Bücher, obwohl sie mir gefallen, so sperren, besprochen zu werden. Ich versuche nun endlich das Buch in meine Worte zu fassen. Bereits im Klappen-Werbetext heißt es, dass der Roman an einem einzigen Tag spielt, und das ist auch das Einzige, was mich an dem Roman störte: Ich hätte zu gerne gewusst, wie es mit den drei jungen Protagonist*innen weiter geht. Doch von vorne:
Es ist der Tag vor dem Ausbruch des ersten Weltkriegs, der 31.7.1914. Hans, Knecht auf einem Bauernhof in Tirol zieht es in die große Stadt. Er hat eine seltsame „Gabe“: er kann Gedanken, die andere gleich aussprechen werden, bereits vorab hören. Um dieses Phänomen abklären zu lassen, flüchtet er eines Nachts nach Wien, wo er bei einer bekannten Psychiaterin vorstellig werden will. Hans ist eigentlich bürgerlicher Herkunft, muss aber nach dem Tod des Vaters die Schule abbrechen und als Stallknecht arbeiten. Gleichzeitig ist er aber begierig nach Bildung. Durch einen glücklichen Zufall findet er einen Mentor in Form des Vikars seines Dorfes. Durch ihn bekommt er Bücher, mit ihm spricht er darüber, Philosophie und auch Politik füllen die Gespräche.
In Wien angekommen, ist Hans überwältigt von der Stadt: die Lautstärke, die vielen Menschen, die Gerüche. Überfordert macht er sich auf die Suche nach der Adresse jener Psychiaterin und findet tatsächlich Gehör bei ihr. Am nächsten Tag darf er zu einem Gespräch kommen. Doch was macht er bis dahin? Zufällig begegnet er im Treppenaufgang Klara und Adam, die ihn in ein Gespräch verwickeln und ihn, als sie von seiner Situation erfahren gleich unter ihre Fittiche nehmen. Klara und Adam haben ebenfalls „Therapiestunden“ bei Helene, weil sie mit eigenartigen Talenten ausgestattet sind, wobei sie bei Klara bis weit ins Private hineinreichen.
„Hans war aber noch so in Klara investiert, dass er kaum bemerkte, wie sich der Hagere, den er vorhin im Warteraum versehentlich applaniert hatte, zwischen ihnen hindurchschlängelte und vor sie stellte.“
Hans ist fasziniert von der klugen, selbstbewussten Klara, die Mathematik studiert (aus dieser Disziplin stammt auch der wundersame Buchtitel) und ganz unkonventionell auftritt. Adam, der Sohn einer adligen Familie, der sich der Musik verschrieben hat, soll am nächsten Morgen in den Krieg ziehen. So will es der Vater. Zunächst erleben wir Adam bei einer Probe mit seinen Mitstudenten – hier wird gerade Schönberg entdeckt –, die allerdings eskaliert, weil es um die Teilnahme am Krieg zu Streitigkeiten kommt. Adam kommt mit blauem Auge davon und nimmt Hans und Klara mit zu sich nach Hause. Hans kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus, als sie das palastähnliche Haus betreten. Hans darf baden und erhält frische Kleidung. Sie nehmen am Bankett teil, dass Adams Vater am Abend ausrichtet. Fast nur Offiziere mit ihren Frauen sind dabei. Es wird über die Notwendigkeit des Krieges diskutiert. Klara als Pazifistin kann das nicht mit anhören und mischt sich ein. Hans hält sich verlegen zurück.
„Nicht richtig, nicht richtig. Die Welt steht in Flammen, Menschenmassen werden sterben, und die Leute reagieren, als sähen sie einen spannenden Film, ein Unterhaltungsstück, wo man zur Zerstreuung die Partei eines Darstellers ergreift.“
Im Anschluss begleiten wir die drei durch das aufgewühlte nächtliche Wien. Wir gelangen durch Halb-, Dunkel- und Unterwelten und in Clubs und Varietés. Vieles ist Hans nicht geheuer – Frauen küssen Frauen, Männer tragen Frauenkleider – wenngleich er fasziniert ist von den Erlebnissen. Zum Schlafen kommen sie nicht. Es scheint, als würde die ganze Stadt dem Morgen zu fiebern. Überall auf den Straßen finden sich junge Männer, die sich freiwillig melden oder schon in Uniform stecken. Sie trinken sich Mut an, treffen ein letztes Mal ihre Mädchen und reden von nichts anderem als dem bevorstehenden Krieg. Fahnen werden geschwenkt, Lieder gesungen. Die Menschen feiern. Unverständlich. So unverständlich wie es mir auch aktuell erscheint, einen Krieg zu unterstützen.
„Nur die Fadisierten, die nie um ihr Leben kämpfen mussten, wollen in den Krieg ziehen, um einmal das Existenzielle zu erfahren. In den Vorstädten, wo das Wasser durchs Dach läuft, leben derweil die erzwungenen Materialisten.“
Da Klara am nächsten Morgen eine wichtige Prüfung hat, führt sie ihre Gefährten auch in ihr früheres Zuhause, ein Armenviertel, um dort Unterlagen zu holen. Mit ihrer Familie will sie nichts mehr zu tun haben. Auch hier ist Hans erstaunt, dass man hier in diesem Elend leben kann. Gegen Morgen machen sie sich auf den Weg zu Klaras Universität, doch es ist kaum ein Durchkommen, die Prüfung wird schließlich inmitten abgebrochen, da junge Männer in Uniform entscheiden, der Krieg sei wichtiger als eine Prüfung, zumal die einer Frau.
Ich finde Edelbauers teils exaltierte Art zu schreiben sehr stimmig für diesen Roman. Sie arbeitet die Unterschiede von arm und reich gut heraus, die letztlich auch heute noch so zu finden sind. Auch die seltsamen (Traum-)Sequenzen, die auf Unerklärliches Übernatürliches hinweisen, empfand ich passend. Vielfach wurde angemerkt, dass ihre Sprache zu altmodisch und überfrachtet sei, dass zu dieser Zeit keiner so geredet hätte. Für mich geht es sich aber gut zusammen aus, um es österreichisch zu sagen. Es geht sich alles aus. Auch die Geschichte, die natürlich offen lässt, wie es mit Hans weitergeht, ob er womöglich auch noch in den Krieg ziehen will. Nachdem die Psychiaterin Helene ihn seiner Illusionen bezüglich seiner besonderen Fähigkeiten beraubt hat, wäre auch das möglich … denn die Propaganda auf offener Straße ist immens. So gesehen, ist dieser Roman auch hochaktuell.
Der Roman erschien im Klett-Cotta Verlag. Eine Leseprobe gibt es hier hier. Ich danke dem Verlag für das Rezensionsexemplar.