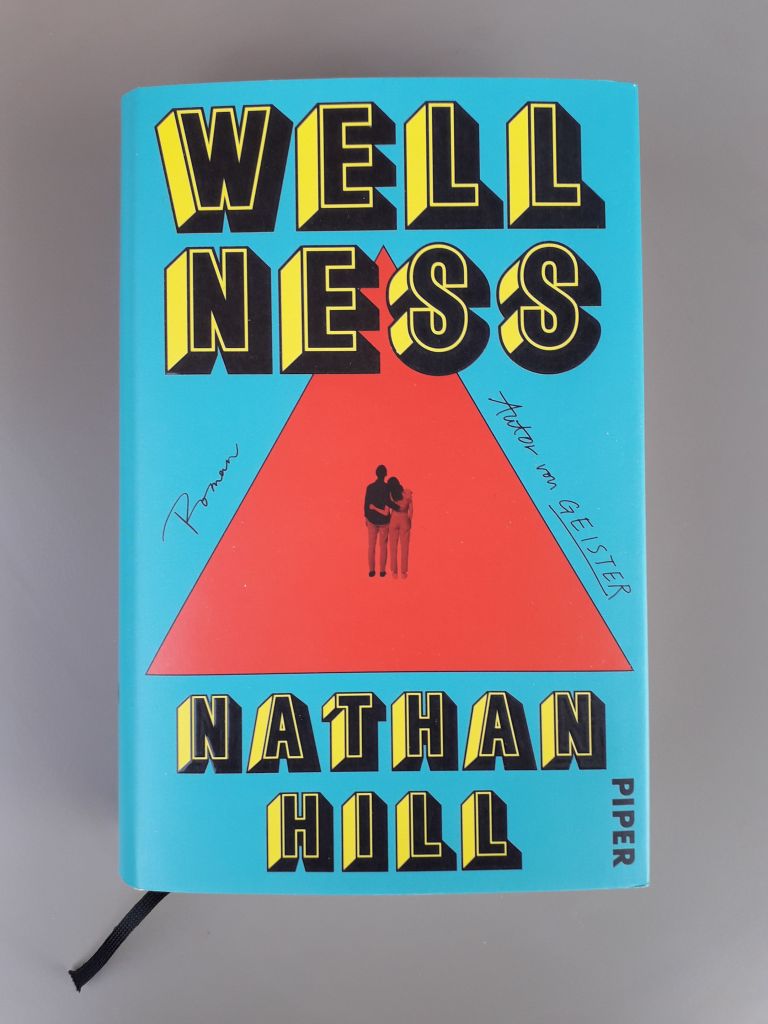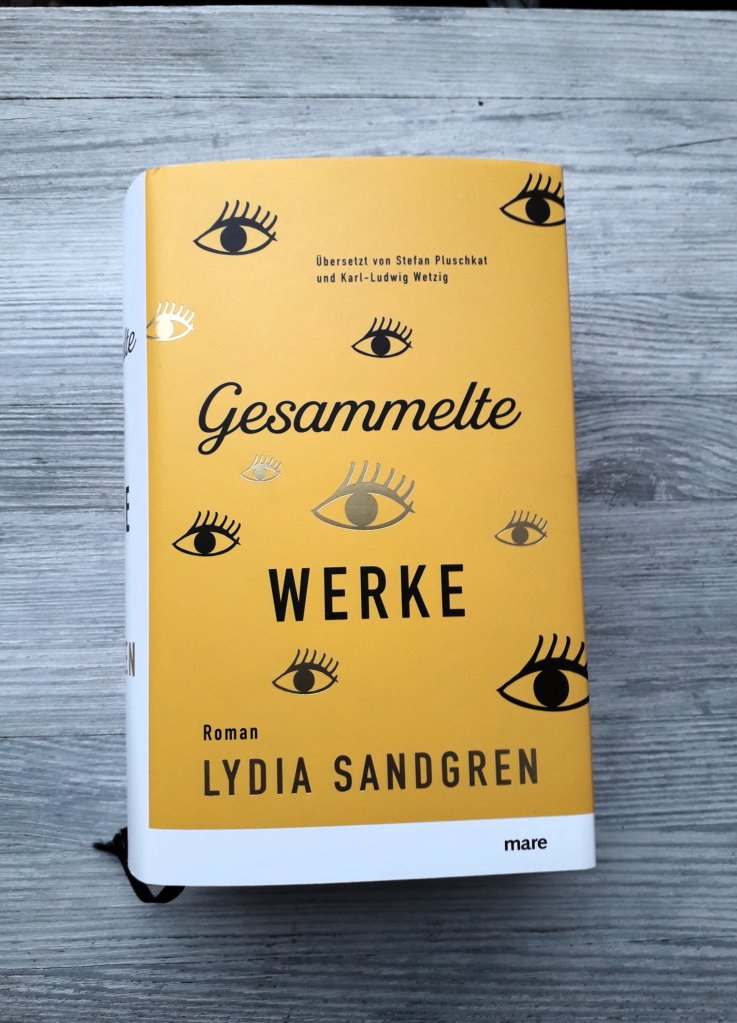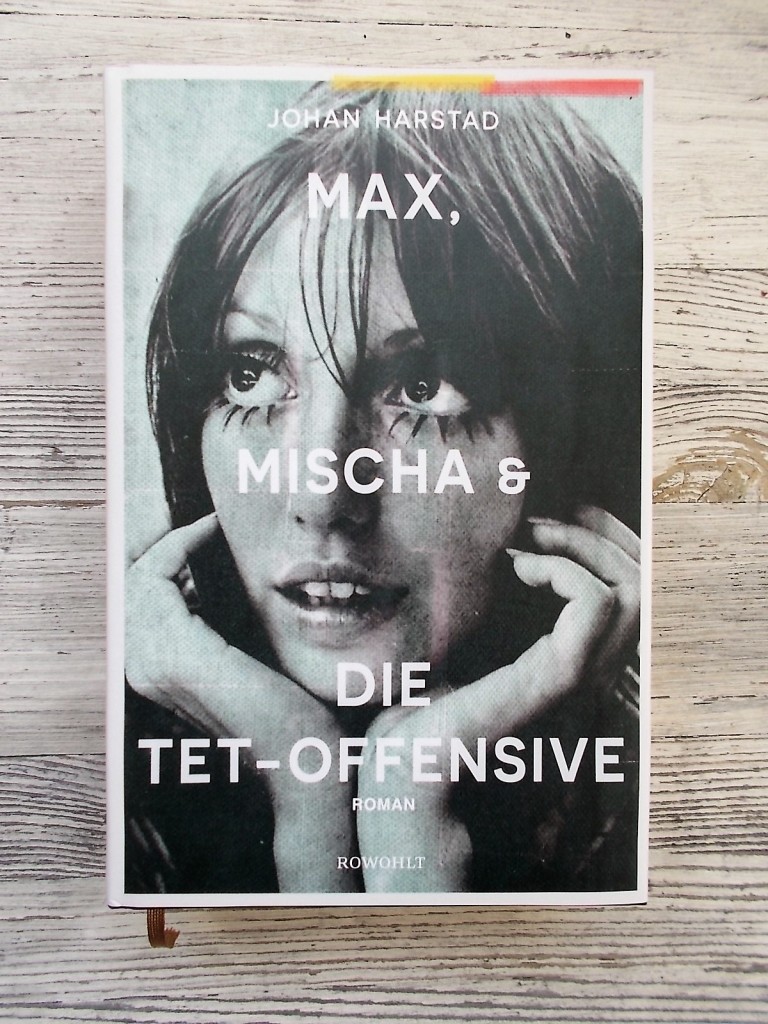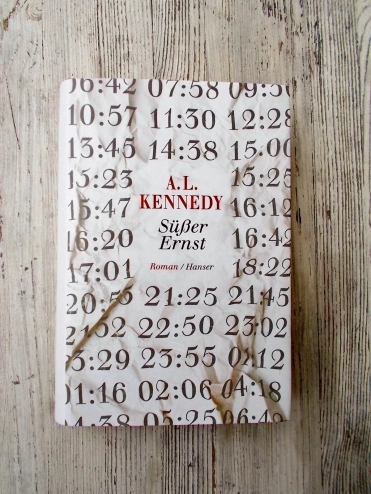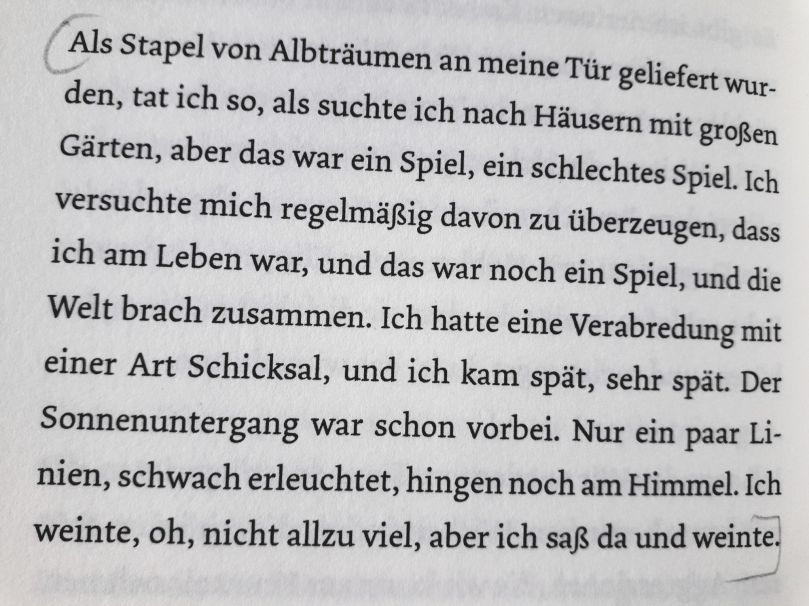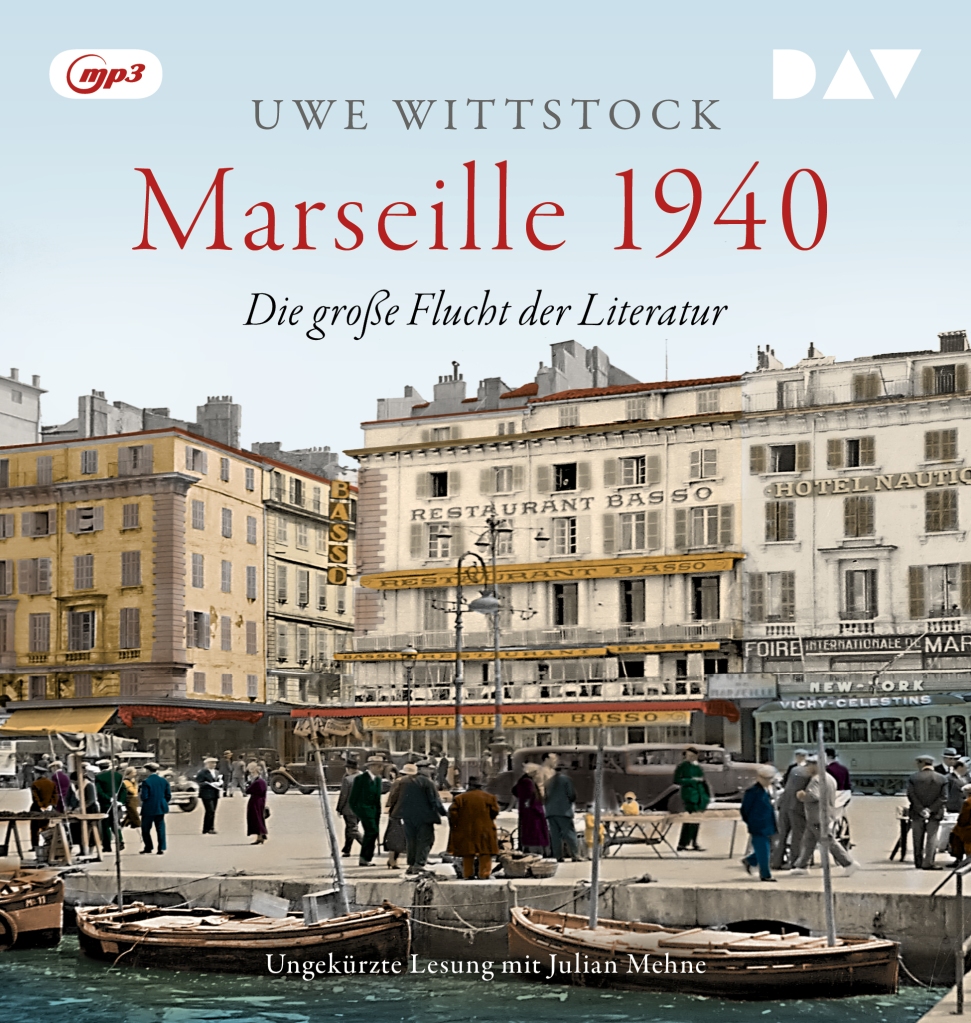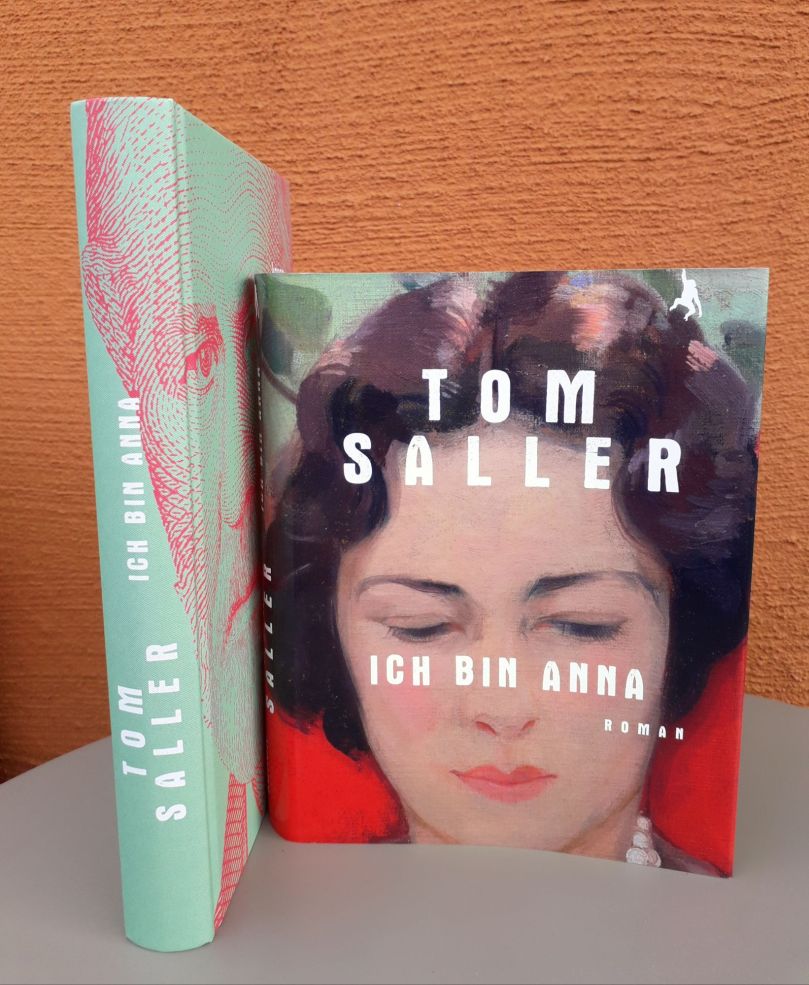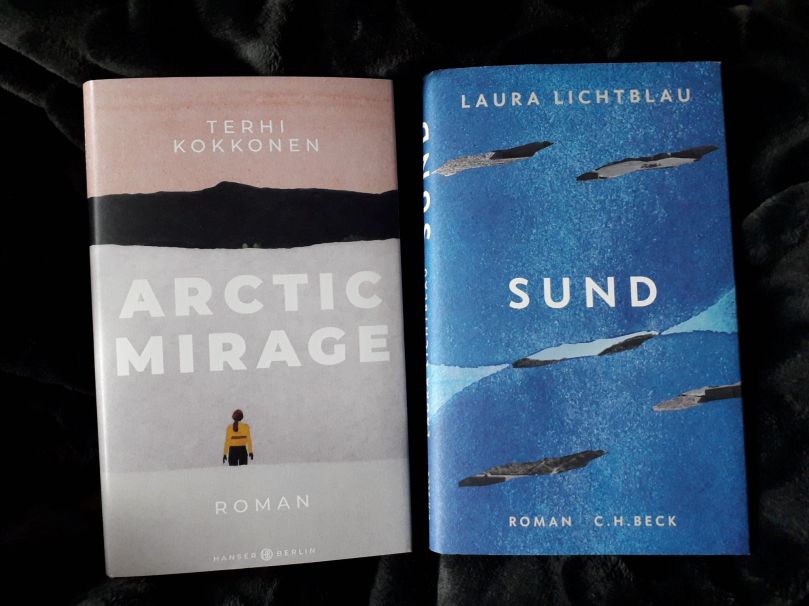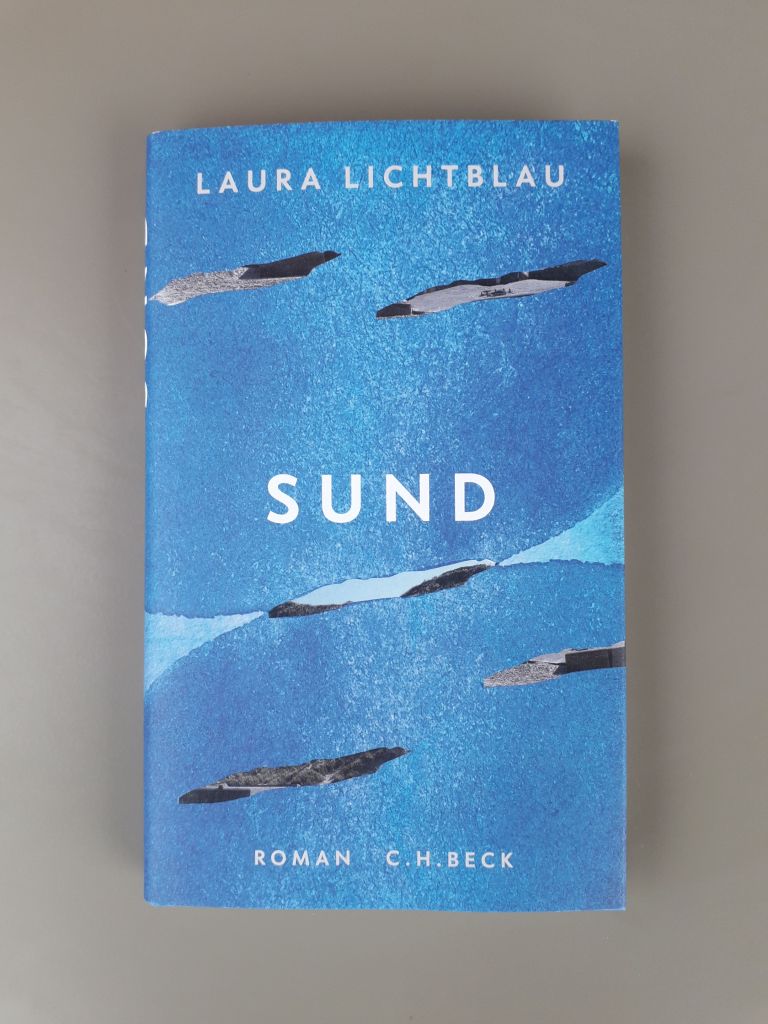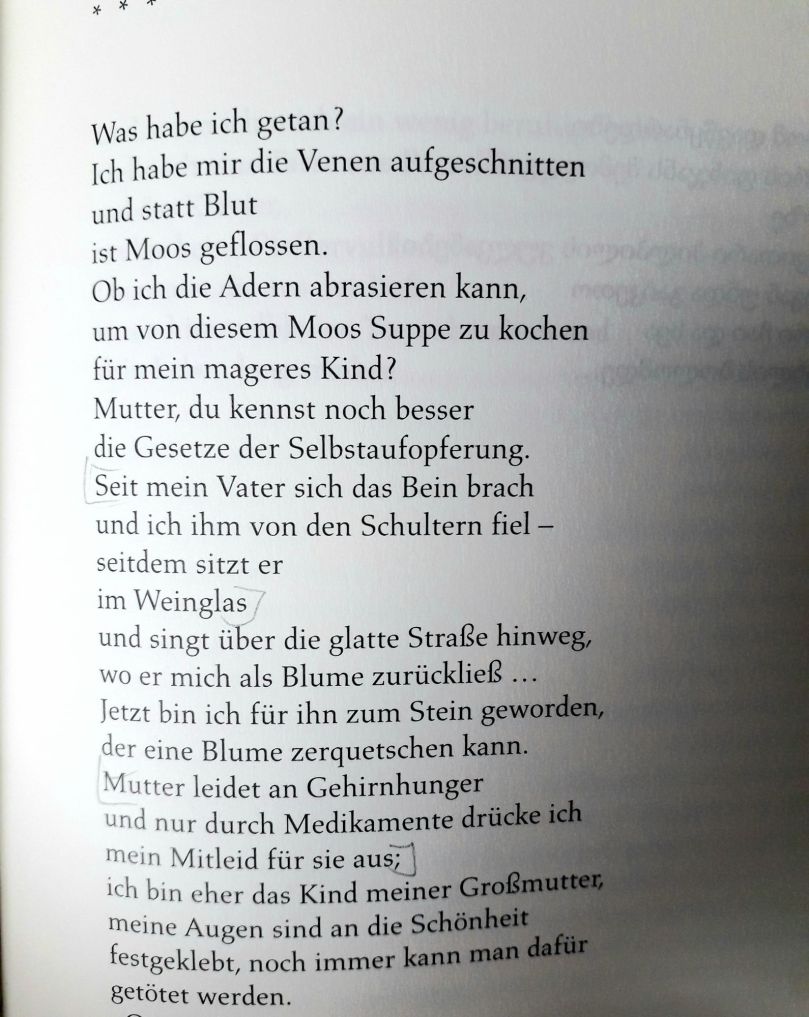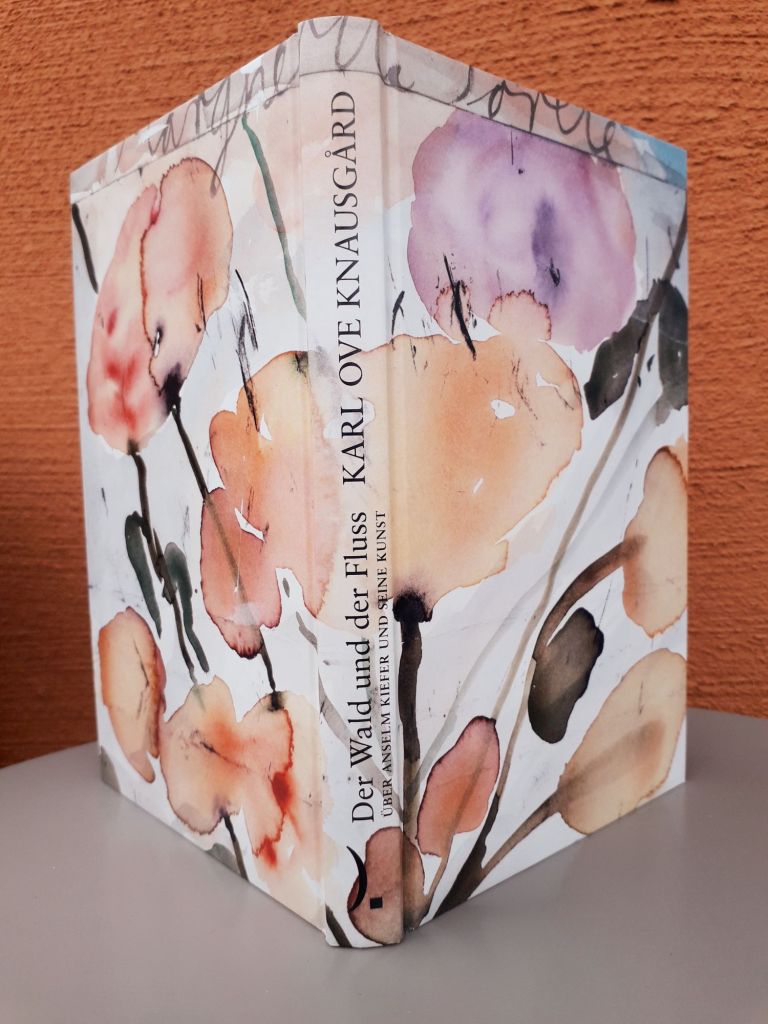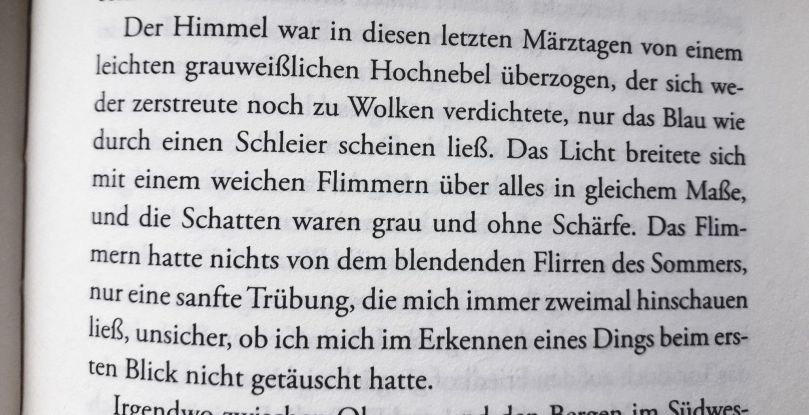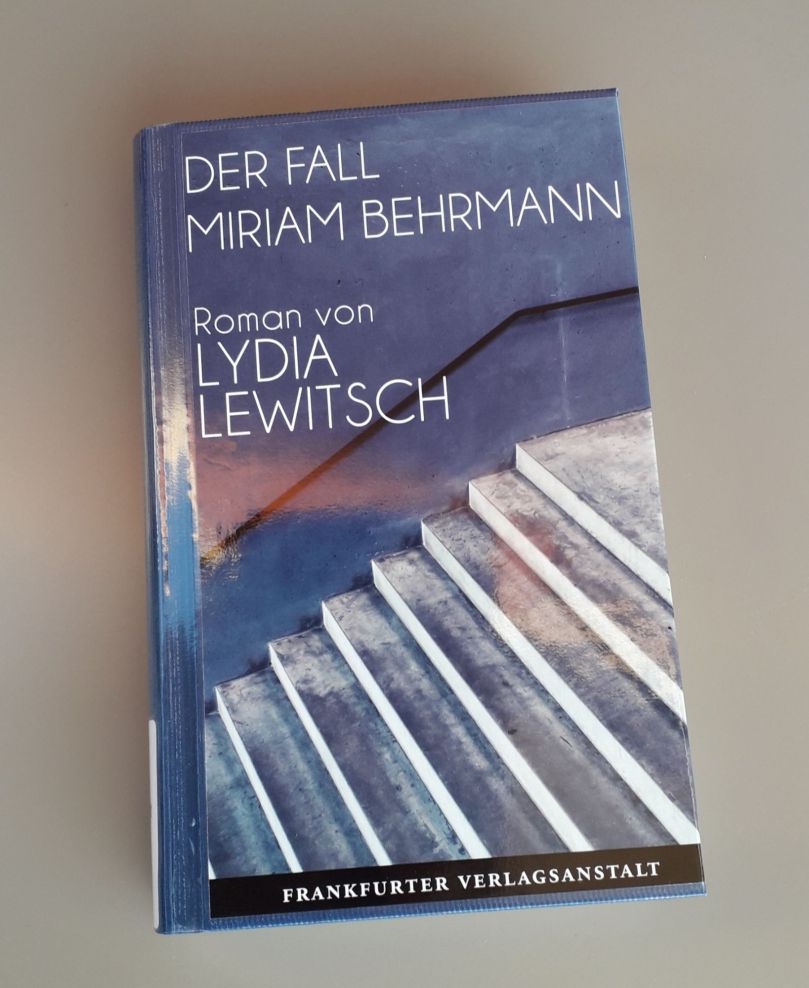
Lydia Lewitschs „Der Fall Miriam Behrmann“ ist der Debütroman der Autorin und Philosophin, die unter anderem Namen bereits Texte über wissenschaftliche und gesellschaftspolitische Themen herausgegeben hat. Sie schreibt über ein brisantes Thema, dass derzeit aktueller nicht sein könnte. Es geht um die sogenannte Cancel-Culture (für mich ist es das) an einer Universität, die es aus den USA längst auch zu uns nach Deutschland geschafft hat. Was mir an diesem Roman besonders gefällt, ist die Tiefe, die Dichte und der sprachlich gelungene Stil, der durch die Geschichte leitet. Hier wird nicht oberflächlich oder plakativ, wie derzeit so oft, über ein mainstream-Thema geschrieben, sondern hier ist das Thema Philosophie, um das es auch inhaltlich geht, wirklich ein wichtiger Aspekt.
Worum es im Roman genau geht: Miriam Behrmann, Professorin für Philosophie und Leiterin eines Instituts an einer Uni in Wien wird von ihrer Doktorandin des psychischen Missbrauchs angeklagt. Miriam Behrmann steht am Tag der „Verhandlung“ bzw. des „Urteils“ im Foyer ihrer Abteilung und fragt sich wie das alles geschehen konnte. Weiter zuvor, als sie davon erfuhr, von ihrem Vorgesetzten Peter, mit dem sie freundschaftlichen Umgang pflegt, konnte sie es überhaupt nicht fassen, was man ihr da unterstellte. Doch sie wurde sofort suspendiert. Sogar in der Zeitung stand es. Nun wird über sie entschieden. Man diskutiert, ob sie der Universität verwiesen, entlassen wird.
„Und ich bin die Ahnungslose. Ich, die diskret blieb, immer, nie herangetreten bin an die Presse, nicht ich. Psychischer Missbrauch! Selina, meine Doktorandin. Dass das von ihr kommt. Selina, perfekt geschminkt, roter Lippenstift: Ich wurde psychisch missbraucht. Wie man auf so etwas kommt. Das eine Zeitung das abdruckt, nur weil sie es so sagt.“
Vor 5 Jahren hatte Peter sie und ihren Mann Tom von der Universität Princeton abgeworben. Sie hatte ein neues Institut gegründet, erfolgreich geleitet. Selina Aksoy, türkischstämmige Deutsche, hatte sich bei ihr als Doktorandin beworben und die beiden arbeiteten gut zusammen, auch mit den drei anderen Mitgliedern der Arbeitsgruppe. Zeitweise teilte Selina sehr viel Persönliches mit Miriam. Auch wir Leser erfahren davon. Von den Problemen zuhause, von den Erwartungen der Eltern, deren Tochter trotz Migrationshintergrund so viel erreichte. Doch nach und nach veränderte sich etwas an der Beziehung.
In einem einzigen großen Bewusstseinsstrom folgen wir Miriam Behrmann in die Vergangenheit. Sie denkt an die Mutter, die Familie in Polen – ja, auch sie hat Migrationshintergrund, sie denkt über ihren Aufstieg nach, das Studium im Ausland, den Arbeitsrausch in Princeton mit einem begnadeten Professor als Mentor. Sie reflektiert ihre Ehe mit Tom, die Geburt der Tochter. Gleichzeitig und auch immer miteinander vermischt und doch aufeinander aufbauend, die Fragen, ihre Stellungnahme, die die Entscheider an der Uni ihr endlich schriftlich zukommen ließen. Der Anwalt, der ihr rät, sich möglichst kurz und sachlich auszudrücken.
Die Fragen, die sie mit Selinas Vorwürfen konfrontieren, lassen Miriam erstarren. Sie und Miriam scheinen eine gänzlich andere Sicht auf die Geschehnisse zu haben. Im Grunde geht es meiner Meinung nach eigentlich um eine anderes Verhältnis zur eigenen Arbeit und um unterschiedliche Arten von Ehrgeiz. Selina zieht es vor sich nebenher in typischer Influencer-Art politisch an der Uni zu engagieren, was immer mehr Arbeitszeit raubt, während Miriam einzig in und durch ihre geliebte Arbeit für das Institut lebt. Selina empfindet Miriams Kritik an ihrer Arbeitsweise als blockierend und übergriffig. Miriam meint sie als Ansporn bzw. als Rat, sich wieder mehr und weiter für die Doktorarbeit zu engagieren. Meinem Empfinden nach reden die Hauptpersonen aneinander vorbei, statt miteinander das Problem zu lösen. Die impulsive Selina ist dann schnell dabei, ihr Problem nach außen zu tragen und wird, wie es in dieser Zeit halt so ist, von allen sofort gehört und unterstützt, ohne Hintergründe zu kennen. Aus Angst etwas falsch zu machen und womöglich selbst am Pranger zu landen, hat man dann schnell seine Schuldige auserkoren. Und so muss Miriam erschüttert feststellen, wie schnell sie von Bekannten, Freunden und Arbeitskollegen fallen gelassen.
„Tom, in Geräuschen wirkt er größer als in der Stille. […] Wir sehen uns an. Sich wieder verbinden: zwei Müdigkeiten, die wie Wasserfarben ineinanderlaufen. Tom … Seinen Namen, mehr schaffe ich nicht. Sein Blick bricht meinen ab, er guckt an mir vorbei auf meinen Bildschirm. Miriam, sieh mal. Wir haben lange geredet, Peter und ich; er meint es nur gut.“
Ich gebe zu, ich habe schnell Sympathien für die Hauptfigur, die „Angeklagte“ und eine Abneigung gegen die Anklägerin entwickelt. Ich nehme Partei ein, was die Autorin überhaupt nicht tut. Zum Gutteil liegt das sicher daran, dass ich näher am Alter von Miriam Behrmann bin als am Alter der Doktorandin. Und ich denke das Hauptaugenmerk liegt auch auf der Generationenfrage. Voller Einsatz im Job, volle Hingabe an die geliebte Arbeit? Ja, das kenne ich auch.
Die Autorin lässt das Ende weitgehend offen (?). Und das Ende ist in dem Sinne auch gar nicht wichtig, da in der Geschichte und ihrer genauen Sprache selbst alles, alles zu finden ist, was die Faszination an diesem Roman ausmacht. Was ich hier über das Buch schreibe, ist nur eine Art Gerüst. So viel steht außerdem zwischen den Zeilen. Große Empfehlung! Ich wünsche der Autorin viele Leserinnen.
Der Roman erschien bei Frankfurter Verlagsanstalt.