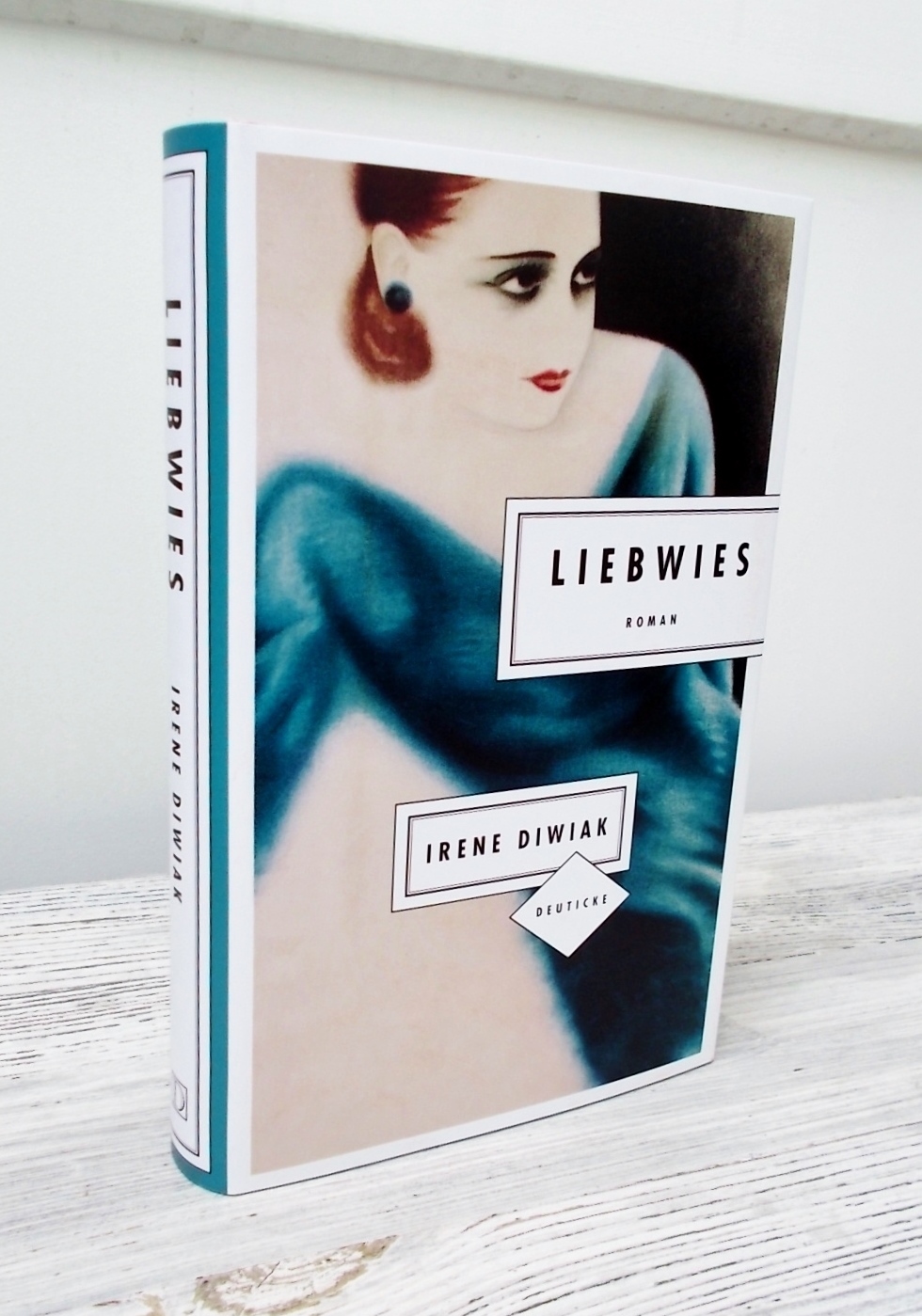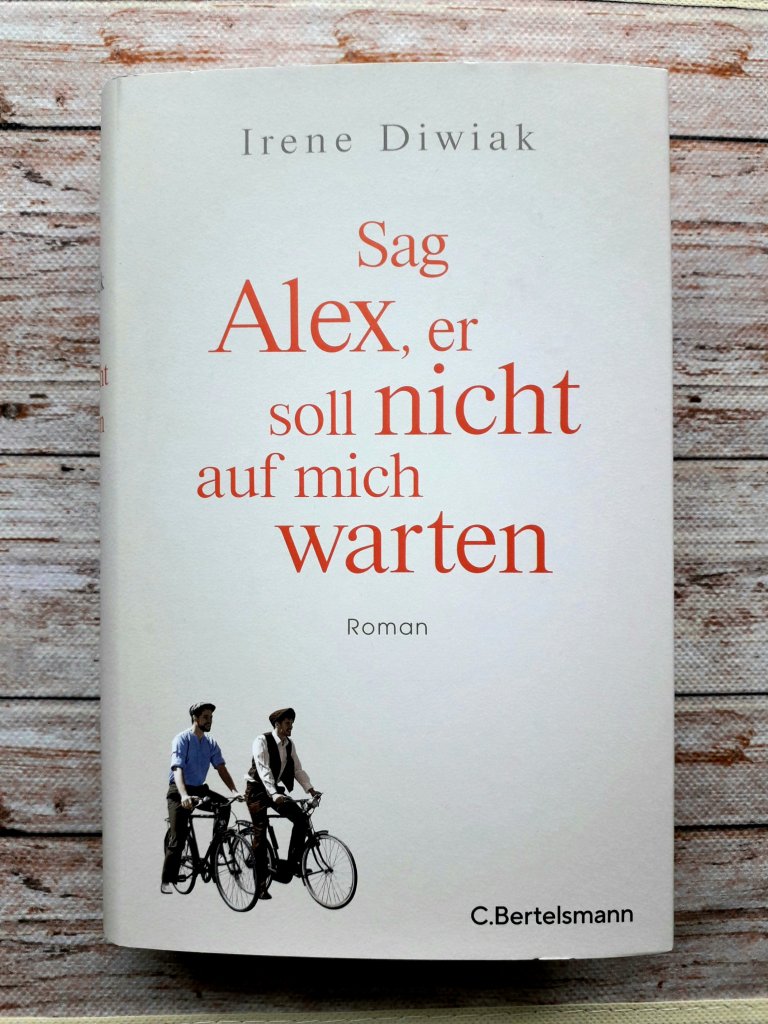
Nach ihrem Romandebüt „Liebwies“ das mich sehr begeistert hat und dem zweiten Roman „Malvita“, gibt es nun von der Österreicherin Irene Diwiak einen neuen Roman: „Sag Alex, er soll nicht auf mich warten“, der sich an einer historischen Figur orientiert und der ebenso gelungen und fesselnd ist, ist jedoch aufgrund der Thematik wesentlich ernster. Es ist schon erstaunlich, wie die Autorin solch unterschiedliche Themen gekonnt meistert. Der Roman erschien bewusst am 22.2.23 zum 80. Todestag von Hans und Sophie Scholl. An diesem Februartag 1943 wurden die Geschwister beim Verteilen ihrer Flugblätter des Widerstands gegen den Nationalsozialismus an ihrer Universität in München vom Hausmeister an die Gestapo verraten. Kurz darauf wurden sie hingerichtet. Der Titel des Buches entspricht wohl den Worten, die Hans kurz nach der Festnahme einer Freundin zugerufen haben soll. Mit diesem Ende beginnt die Autorin ihren Roman.
„Da muss man doch etwas tun!, und wir haben doch etwas getan, aber nie genug, niemals ist es genug, und wenn es schließlich Sophie ist, die es ausspricht: So geht es nicht mehr weiter. Wir müssen die Flugblätter auf die Universität bringen. Ja, am hellichten Tag.“
Irene Diwiak hat sich mutig eines Stoffs angenommen, von dem man niemals genug lesen kann. Zudem hat sie diesen wirklich feinfühlig und sorgfältig behandelt, nah an historischen Daten, aber eben doch fiktional eigen. Sie nimmt in ihrem Roman eine andere Perspektive ein, als die, die man sonst über die „Weiße Rose“ liest. In den meisten Büchern und Filmen ist Sophie im Fokus. Sie beginnt mit Hans Scholl, der beim Appell des Wehrsports 1941 auf den ebenfalls Medizin studierenden, aber eigentlich in Richtung Bildende Kunst orientierten Alexander Schmorell trifft. Schnell verbindet sie eine enge Freundschaft. Beide waren bereits 1940 als Sanitätsoffiziere an der Front und sind nun zunächst fürs Studium freigestellt. Sie treffen sich abends oft mit Freunden und Studienkollegen und diskutieren über Philosophie, Kunst, Literatur, Musik. Anfangs nimmt die politische Situation nur wenig Platz ein, doch als ein Architekt, der ihnen während seiner Arbeitsabwesenheit seine Räume für die Treffen zur Verfügung stellt, von den Gräueltaten der Nationalsozialisten, von der Verfolgung und Ermordung der Juden, die er mit eigenen Augen gesehen hat, erzählt, ändert sich etwas grundlegend. Es erschüttert Hans und Alex so sehr, dass sie beginnen über Veränderungen nachzudenken.
In Rückblenden erfahren wir mehr aus dem Leben und der Familie von Hans und Alex, die Zeit, die sie geprägt hat. Alexander hat russische Wurzeln und ist als kleines Kind nach Deutschland gekommen. Er hat seine russische Mutter verloren. Er studiert Kunst und hat mit Philosophie wenig am Hut. Hans, der früher ein glühender Freund des Nationalsozialismus war, in der Hitlerjugend, obwohl der Vater, durch und durch Pazifist und religiös, dies nicht erlauben wollte, denkt nun in Richtung Widerstand. Zusammen mit Alex plant er Flugblätter mit aufrüttelnden Texten.
„Ob Hans glaube, fängt der Vater donnernd an, dass es lustig sei, Krieg zu spielen, ob er denn die Unmenschlichkeit kenne, ob Hans etwa im Krieg gewesen sei oder ob das nicht viel eher er selbst gewesen sei, der Vater? Und dass es nur der Anfang sei, Andersdenkende mit der Faust zu bekämpfen, dass bald schon Gewehre und Bomben zum Einsatz kommen werden, das sei es nämlich, was dieser Hitler wolle, und ob Hans denn wirklich zu dumm sei, um das zu verstehen?“
Bald jedoch werden sie erneut als Sanitätsoffiziere ins Lazarett an der Front, diesmal nach Russland abgerufen. Alex, der Russisch spricht, findet hier Freunde und spürt, dass dies sein Heimatland ist. Er schwört, niemals zu schießen und erlebt sich als vollkommen anderer Mensch – er scheint nach Hause gekommen. Als Sanitätsoffiziere sind sie nicht so stark gefährdet, erleben aber bei einem Zwischenstopp in Warschau den Wahnsinn des Warschauer Ghettos. Als sie nach Monaten Heimaturlaub bekommen, überlegt Alex sogar, sich den russischen Partisanen anzuschließen. Eine Erkrankung verhindert das.
„Wenn sie von zerstörten Städten und Dörfern erzählen. Wenn sie erzählen, dass Russland brennt. Wenn sie erzählen, dass es ihnen nicht leidtut, dass noch mehr brennen muss, dass die Russen keine Menschen sind, kein Recht auf Leben haben, weniger wert seien als Tiere. Dann, ja, dann würde Alex ganz weit ausholen und dem Halbgefrorenen im Krankenbett ganz unverfroren ins Gesicht schlagen müssen.“
Während Alex nun eher halbherzig bei der Herstellung und Vervielfältigung der Flugblätter mitmacht, können sie einen Universitätsprofessor überzeugen mitzuwirken und Sophie wird wichtiger Teil der Gruppe. Enge Freunde schließen sich an. Besonders auch Willi, ein Mitstudent, der sich an seine christlichen Glaubensfreunde wendet. In ganz Deutschland, ja sogar bis ins Ausland versuchen sie nun neue Gruppen aufzubauen, doch es scheint als wollen sich die Menschen nicht aufrütteln lassen, als wäre es immer zu wenig, was sie tun. Stehen wirklich alle trotz jahrelangem Krieg hinter diesem fanatischen Führer? Haben die Menschen einfach nur Angst und wollen irgendwie überleben? Als Leserin stellt man sich natürlich gleich stellvertretend die Frage: Wäre ich damals so mutig gewesen und Teil des Widerstands geworden?
Obwohl man die Geschichte kennt, obwohl man weiß, wie es ausgeht, vermag die Autorin einen doch unglaublich zu fesseln. Es entsteht ein Lesefluss, fast könnte man das Buch einen Pageturner nennen. Das liegt sicher auch daran, dass wir die Hauptfiguren genauer kennenlernen und ihnen nahe kommen. Die einzelnen Charaktere sind gut herausgearbeitet. Ich bin verblüfft, wie sehr ein Perspektivwechsel gleich ein neues Licht auf das Thema wirft. Diwiaks Erzählart ist auf sprach- und inhaltlicher Ebene absolut gelungen. Große Empfehlung!
Im ausführlichen Nachwort erzählt die Autorin über ihre Herangehensweise an das Thema und über ihr Schreiben und auch wie plötzlich der Krieg während der Arbeit am Roman wieder aktuell in die Nähe rückte. Ich selbst war und bin sehr erschrocken, wie stark sich die Entwicklungen damals und heute ähneln (siehe obige Zitate) und wie wenig Menschen doch aus der Geschichte lernen. Ich werde das nie verstehen. Frieden! Peace!
Das Buch erschien im C. Bertelsmann Verlag. Eine Leseprobe gibt es hier. Ich danke dem Verlag für das Rezensionsexemplar!